Quittung fehlt? Kein Grund zur Sorge: der Eigenbeleg rettet den Steuertag
Der steuerliche Eigenbeleg – Bedeutung und Anforderungen an die Taxi-Praxis.
Der Eigenbeleg ist ein zulässiger Ersatznachweis, wenn die Fremdrechnung unverwertbar oder nicht mehr vorhanden ist (z.B. unleserlich, versehentlich zerrissen, verloren gegangen ist usw.).
Er dokumentiert die jeweilige Betriebsausgabe, ist aber kein gleichwertiger Ersatz für eine umsatzsteuerliche Rechnung (Vorsteuerabzug fraglich). Entscheidend für die Anerkennung eines Eigenbelegs ist die inhaltliche Vollständigkeit, Zeitnähe der Ausstellung, Nachvollziehbarkeit und auch die Unterschrift des Steuerpflichtigen.
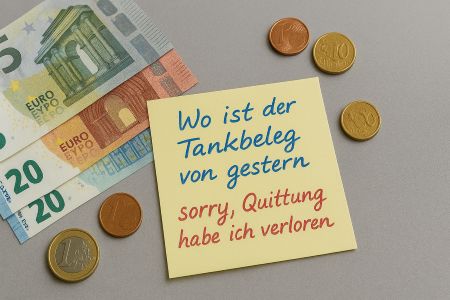
Die branchenspezifischen Aufzeichnungspflichten des Taxi-Unternehmen bleiben von der Ausstellung eines Eigenbelegs grundsätzlich unberührt.
Betriebspraktisch gesehen empfiehlt sich eine geprüfte und steuerlich anerkannte Vorlage („Muster“-Eigenbeleg), die alle relevanten Steuerparameter enthält. Entsprechende Vorlagen bieten Steuerberater oder auch Portale wie DATEV, Lexware oder Haufe.
1. Warum der Eigenbeleg wichtig ist
In der täglichen Buchführung gilt der zentrale Grundsatz „keine Buchung ohne Beleg“. Fehlt eine Quittung (konkrete Beispiele: Verlust original-Beleg, Parkscheinautomat ohne Quittung, Trinkgelderfassung, andere kleinere Barauslagen, für die keine Quittung erteilt wurde) darf ein Eigenbeleg als Not- oder Ersatzbeleg eingesetzt werden, damit die Ausgabe steuerlich berücksichtigt werden kann. Für viele Unternehmen – insbesondere im Personenbeförderungssektor mit häufigen baren Kleinauslagen – ist der Eigenbeleg eine praktische und notwendige Ergänzung zum Fremdbelegwesen.
2. Rechts- und Verwaltungsgrundlagen
- GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung digitaler Unterlagen): Buchhaltungsbelege müssen nachvollziehbar, vollständig und unveränderbar aufbewahrt werden. Wenn kein Fremdbeleg vorliegt, ist ein Eigenbeleg anzufertigen.
- EStG und BFH-Rechtsprechung: Für bestimmte Aufwendungen, wie z.B. bei einer Bewirtung, verlangen EStG und BFH konkrete und nachvollziehbare Angaben (Ort, Tag, Teilnehmer, Anlass der Bewirtung, Höhe der Kosten u.a.). Der BFH fordert neben der Zeitnähe und auch die Unterschrift des Steuerpflichtigen auf dem Eigenbeleg. Diese Vorgaben des BFH bilden die Anforderungen hinsichtlich der Qualität und der Mindestanforderungen eines Eigenbeleges. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung entscheidet die Finanzbehörde nach den Kriterien Plausibilität und Nachprüfbarkeit/Vollständigkeit, ob eine selbst ausgestellte Rechnung anerkannt wird. Die BFH-Rechtsprechung ist besonders kritisch bei strittigen Abzugsfragen (z. B. Bewirtungskosten). Finanzgerichte und Finanzverwaltung orientieren sich an diesen Leitlinien.
3. Drei relevante Entscheidungen
- BFH, Urteil vom 18. April 2012, X R 58/09: Anforderungen an den Nachweis von Aufwendungen und konkretisierte Grenzen, wann Ersatzbelege nicht genügen.
- BFH, Urteil vom 15. Januar 1998, IV R 81/96: Stellt klar, dass Eigenbelege bei Bewirtung formlos möglich sind, aber vom Steuerpflichtigen zu unterzeichnen und zeitnah zu erstellen sind. Unzureichende Angaben führen zum Abzugsverbot.
- BFH, Urteil vom 25. März 1988, III R 96/85: Wichtige Leitentscheidung zur Zeitnähe und inhaltlichen Anforderungen bei Bewirtungsnachweisen (Ort, Tag, Teilnehmer, Anlass).
4. Konkrete Anforderungen: Wie muss ein Eigenbeleg aussehen, damit er steuerlich anerkannt wird?
Aus den GoBD-Vorgaben, dem EStG und der BFH-Rechtsprechung lassen sich verschiedene Mindestanforderungen ableiten, die grundsätzlich den Anforderungen einen Kleinbetragsrechnung entsprechen müssen:
- Datum des Geschäftsvorfalls (entspricht: Tag der Ausgabe des Belegs).
- Genaue Leistungsbezeichnung (z.B. „Parkgebühr am Flughafen“, „Trinkgeld Fahrer xy der Schicht 09.10.2025“, „Ersatz für verlorene Quittung Taxi-Reinigung“ und dergleichen).
- Betrag (Brutto/Netto) und Umsatzsteuersatz – wichtig: Eigenbelege rechtfertigen in der Regel keinen Vorsteuerabzug. Die Angabe dient der Nachvollziehbarkeit.
- Zahlungsempfänger (soweit bekannt) – bei Bargeldausgaben: genaue Beschreibung, z.B. „Trinkgeld – Fahrgast xy“ oder „Parkautomat Flughafen – Parkhaus Terminal 2“.
- Grund für das Ausstellen des Eigenbelegs: z.B. „Originalbeleg verloren“, „kein Parkschein ausgegeben“.
- Ort und Anlass: insbesondere bei Bewirtungen sind Ort und betrieblicher Anlass zwingend.
- Teilnehmer/Begünstigter bei Bewirtungen: vollständiger Name und Funktion des Teilnehmers sowie Grund der Bewirtung.
- Zeitnähe: Der Eigenbeleg muss „kurz“ nach dem Vorgang erstellt werden (also zeitnah), um die Glaubwürdigkeit zu sichern. Eine konkrete Frist nennt die Rechtsprechung dabei nicht, aber: je früher, desto besser.
- Unterschrift des Steuerpflichtigen (bzw. des Ausstellers) ist nach der Rechtsprechung des BFH erforderlich.
Fortlaufende Nummerierung oder Belegkennzeichnung (praktisch: erleichtert Ordnung und Nachvollziehbarkeit). Buchhalterische Ordnungsmerkmale sind nach § 239 HGB ohnehin verpflichtend.
5. Unsere Einschätzung
Ordnungsgemäße Fremdbelege sind das A und O einer jeden Buchhaltung. Das Taxigewerbe unterliegt zusätzlichen Aufzeichnungs- und Zuordnungsregeln (Erfassung des Geschäftsvorfalls nach § 145 AO, Aufzeichnungen nach § 17 Abs. 1 MiLoG, TSE-konforme Datenerfassung des Fahrpreisanzeigers usw.).
Eigenbelege für die oben genannten typische Anwendungsfälle sind zulässig, sie entbinden allerdings nicht von den besonderen Branchen-Aufzeichnungspflichten.

Bei der Ermittlung der Umsatzsteuer (Vorsteuer) bleibt der Eigenbeleg suboptimaler Ersatz: Vorsteuerabzug kann grundsätzlich nicht erfolgen.
6. Für das Taxi gilt:
- Originalbeleg geht vor Ersatzbeleg: Versuchen Sie zunächst einen Ersatzbeleg vom Rechnungsaussteller zu erhalten (Zweitschrift). Der Ersatzbeleg des Beteiligten ist Mittel der ersten Wahl und in jedem Falle glaubhafter als ein schwierig zu verifizierender Eigenbeleg.
- Aus Eigenbelegen kann die Vorsteuer beim Finanzamt nicht geltend gemacht werden, denn die formalen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nach § 14 und § 15 des Umsatzsteuergesetzes sind nicht erfüllt. Eine ordentliche Rechnung ist für den Vorsteuerabzug unerlässlich (§§ 14, 15 UStG).
- Obwohl die gezahlte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann, ist der insgesamt gezahlte Betrag als Betriebsausgabe abzugsfähig.
- Plausibilisierung: Die Ablehnung des Eigenbeleges durch das Finanzamt ist wahrscheinlich, wenn Rechnungsangaben lückenhaft, nicht zeitnah oder nicht plausibel sind. Begründen und dokumentieren Sie deshalb umfangreich, warum ein Ersatzbeleg vorgelegt wird (z.B. Zuordnung des Geschäftsvorfalls, Km.-Stand des Fahrzeugs, Foto des defekten Parkscheinautomaten usw.).
- Beweisvorsorge: Führen und dokumentieren Sie fortlaufende Eigenbelegnummern, scannen Sie Eigenbelege sofort ein (unter Beachtung der GoBD-konformen Speicherung) und stellen Sie relevante Zusatzinformationen zur Plausibilisierung bereit: Taxi-Fahrzeug, Schicht-ID, Fahrername usw.
7. Fazit
Der Eigenbeleg ist ein wichtiges, steuerlich anerkanntes Instrument zur Absicherung kleinerer oder verlorener Belege – auch im Taxi-Gewerbe. Für die steuerliche Anerkennung müssen Inhalt, Zeitnähe, Unterschrift und insbesondere die Nachvollziehbarkeit der Eigenbeleges stimmen. Bei der umsatzsteuerlichen Betrachtung ersetzt der Eigenbeleg jedoch keine formelle Rechnung (Vorsteuer-Abzug nicht möglich). Praktisch empfehlen sich standardisierte Eigenbeleg-Vorlagen, fortlaufende Nummerierung und die digitalisierte, GoBD-konforme Erfassung. Wichtig ist Plausibilisierung: klare interne Zuordnung zu Fahrzeug, Fahrer und Schicht.
Links & Dokumente in diesem Artikel
- Lexware
https://www.lexware.de/tools/vorlage-ersatzbeleg/#generator-fuer-eigenbelege-und-ersatzbelege - Leitlinien
https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2022/C-Anhaenge/Anhang-16/II/anhang-16-II.html - Anforderung an den Nachweis
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201250598 - Eigenbelege bei Bewirtung
https://www.smartsteuer.de/online/lexikon/b/bewirtungsaufwendungen/#D063019600005 - GoBD-Vorgaben
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-11-aenderung-gobd.html